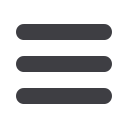
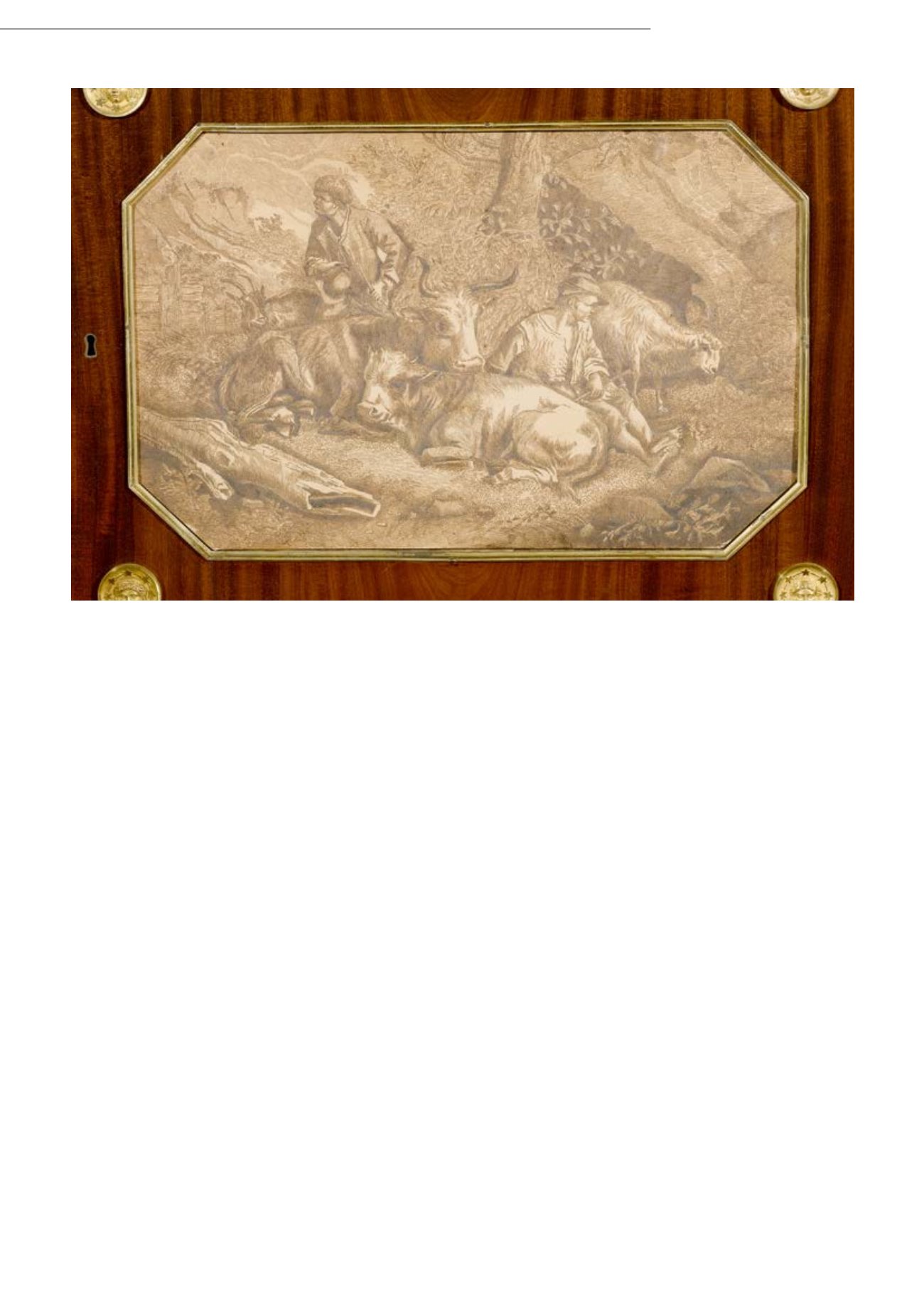
Künstlers markiert dieses Möbel den künstlerischen Übergang von der
Fortführung des Roentgenschen Stils zur eigenständigen klassizistischen
Gestaltung. Durch seine Ausstattung mit Zeichnungen, die mit großer
Wahrscheinlichkeit aus der Hand der Königin stammen, kommt ihm
zudem auch große historische Bedeutung zu. Das Möbel ist nicht nur
in ästhetischer Hinsicht bemerkenswert, es erfüllt auch als praktischer
Gebrauchsgegenstand seinen Zweck und entspricht Klickerfuß‘ Arbeits
ideal: „Er [Klinckerfuß] hatte sich bei all seinen Arbeiten zum Ziel gesetzt,
Schönheit der Form, Bequemlichkeit für den Gebrauch und möglichste
Dauerhaftigkeit zu vereinigen. [...] Nichts war auf bloßen Schein berech-
net, in ansprechend gefälliger Form wurde immer wahrhaft Brauchbares,
vollständig Solides geliefert.“
J. Klinckerfuß, 1770 in Bad Nauheim als Sohn des Schreinermeisters
Philip Klinckerfuß geboren, lernte das Handwerk zunächst bei seinem
Vater, später bei dem Meister Gürtler und wurde 1788 Geselle. Auf seiner
Wanderschaft gelangte er 1789 nach Neuwied in die berühmte Roentgen-
manufaktur, wo er zu einem geschätzten Mitarbeiter und Vertrauten David
Roentgens aufstieg. Er gehörte damit zu den herausragenden Handwer-
kern der Manufaktur, denen David Roentgen nach der Auflösung des
Manufakturbetriebs half, eine angemessene Stellung zu finden. Wohl auf
Roentgens Intervention hin trat Klinckerfuß 1793 zunächst in Bayreuth in
die Dienste der Herzogin Dorothee Sophie von Württemberg (1736-1798),
der Gemahlin des Herzogs Friedrich Eugen (1732-1797). Dieser verlegte
1795 seine Residenz nach Stuttgart, wo 1797 auch Nikolaus Friedrich
Thouret mit der Ausstattung der Schlösser beauftragt wurde. Nach dem
Tod des Regentenpaars wurde Klinckerfuß 1795 vom Nachfolger Friedrich
II. von Württemberg, dem späteren württembergischen König (1754-1816)
und seiner Gemahlin Charlotte Auguste Mathilde (1766–1828). übernom-
men und erhielt schließlich den Titel des „Cabinets-Ebenisten”.
Im Zuge der umfangreichen Ausstattungsarbeiten, besonders für das Neue
Schloss in Stuttgart, wurde Hofwerkstatt vergrößert um das große Pensum
an Möbelbestellungen, die auch für andere Schlösser erfolgten, bewältigen
zu können. Bis zu seiner Entlassung 1812 erwarb er sich hohes Ansehen als
Ausstatter der aufwändig geplanten württembergischen Schlossbauten.
Nach 1812 arbeitete Klinckerfuß als selbständiger Ebenist und erhielt vor
allem unter dem Nachfolger Friedrichs II., König Wilhelm I. (1781-1864)
neuerliche Aufträge vom Hof. Bis ca. 1830 lieferte Klinckerfuß um die 400
Möbel an die Krone; er starb 1831.
In seinem Werk schließt sich nach einer frühen Phase der stark an
den Werken der Roentgenmanufaktur ausgerichteten Gestaltung eine
eigenständigere, vor allem an der französischen Möbelkunst orientierte
Formgebung an.“
Lit.: C. Cornet, Beobachtungen zu den Fertigungsbesonderheiten in der
Roentgenmanufaktur, in: W. Thillmann / B. Willscheid (Hg.), AK Möbel
Design Roentgen, Thonet und die Moderne. Neuwied 2011, S. 103-117.
Ibid., Roentgenmöbel in Münchener Museen. Folge 12: Schreibtisch mit
Aufsatz, um 1785-1790, Bayerisches Nationalmuseum, in: Weltkunst 7
(1992); S. 908-911. D. Fabian, Abraham und David Roentgen. Das noch
aufgefundene Gesamtwerk ihrer Möbel- und Uhrenkunst in Verbindung
mit der Uhrmacher-Familie Kinzing in Neuwied, mit Werkverzeichnis.
Bad Neustadt 1996. Ibid., Roentgenmöbel aus Neuwied. Bad Neustadt
1986. J.M. Greber, Abraham und David Roentgen. Möbel für Europa,
Starnberg 1980. H. Huth, Abraham und David Roentgen und ihre Neu-
wieder Werkstatt, München 1974. Ibid., Abraham und David Roentgen
und ihre Neuwieder Möbelwerkstatt, Berlin 1928. W. Wiese, Die Zei-
chenmappe des Ebenisten Johannes Klinckerfuß (1770-1831) - Möbelzeich-
nungen des Empire und Biedermeier, Regensburg 2013. Ibid., Königliche
Möbel in Schloß Ludwigsburg. Johannes Klinckerfuß Ein württembergi-
scher Ebenist (1770-1831) Begleitheft zur Ausstellung Schloß Ludwigsburg
1989. Ibid., Johannes Klinckerfuß. Ein württembergischer Ebenist (1770-
1831), Sigmaringen 1988. Ibid., Johannes Klinckerfuß und die Stuttgarter
Möbelkunst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, in: Baden und Württemberg
im Zeitalter Napoleons: Ausstellung des Landes Baden-Württemberg, II,
Cantz, 1987.
CHF 120 000 / 200 000
(€ 111 110 / 185 190)
Möbel & Kunstgewerbe |
Möbel, Uhren, Tapisserien, Bronzen, Sakrale Skulpturen, Porzellan, Silber
| 134
















