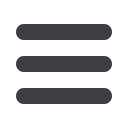
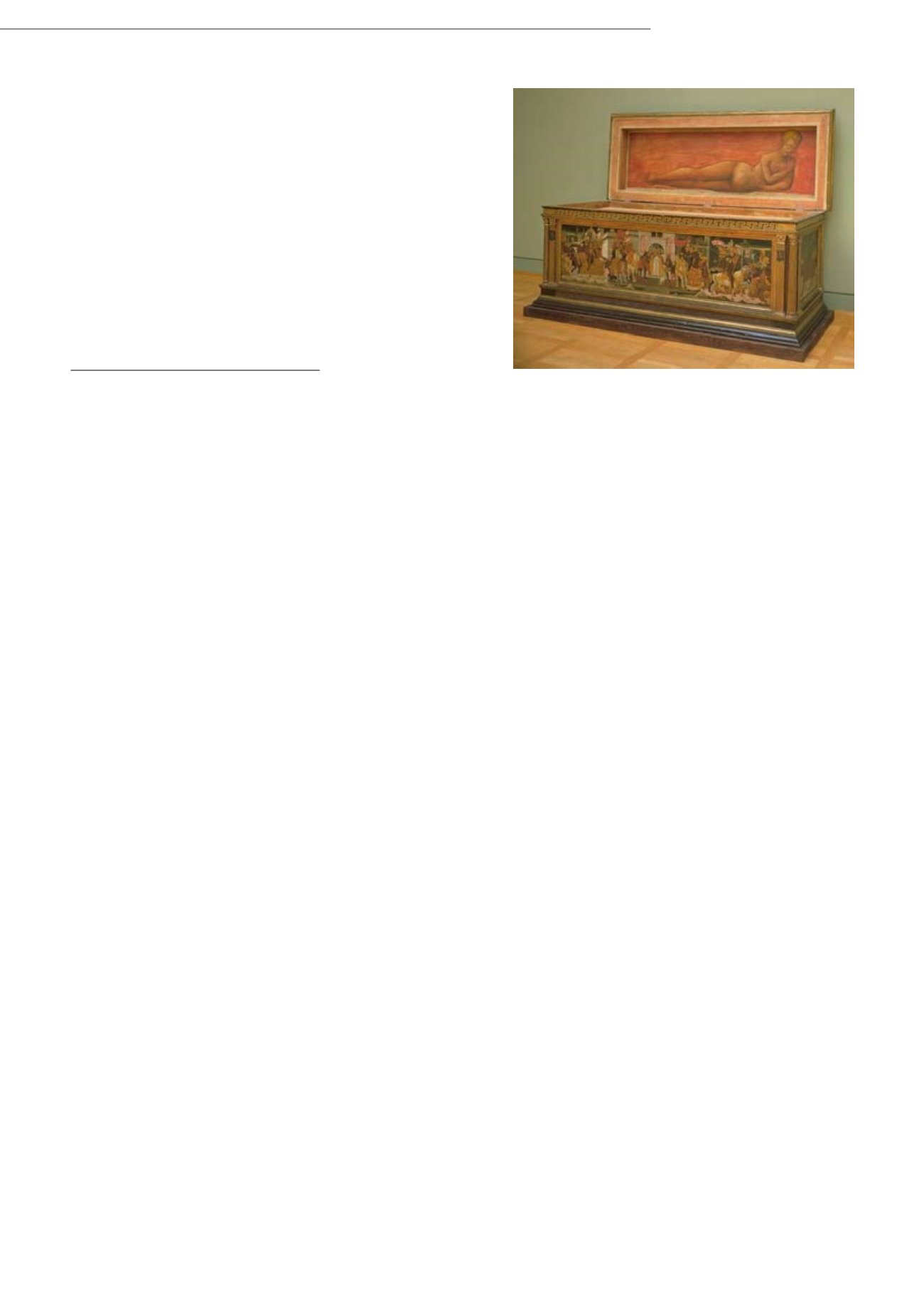
3013*
BADALONI, PAOLO DI STEFANO genannt PAOLO SCHIAVO(Florenz 1397 - 1478 Pisa)
Venus und Amor. Um 1440-45.
Tempera auf Holz.
50,8 x 170 cm.
Provenienz:
- Sammlung L. Grassi, Florenz, um 1971.
- Sammlung J. Paul Getty Museum, Malibu,
1972-1992, Inv. Nr. 72.PB.9 (verso Etikette).
- Auktion Christie‘s, New York, 21.5.1992.
- Museo Privato Bellini, Florenz (verso Etikette
“Mr. Luigi Bellini”).
- Europäische Privatsammlung.
Ausstellungen:
- Art and Love in Renaissance Italy, Metropo-
litan Museum of Art, New York, 11.11.2008-
16.2.2009, Nr. 58b (verso Etikette).
- Doni d‘amore. Donne e rituali nel Rinasci-
mento, Pinacoteca cantonale Giovanni Züst,
Rancate (Mendrisio, Schweiz), 12.10.2014-
11.1.2015, Nr. 31.
Literatur:
- Callmann, Ellen: Un Apollonio di Giovanni
per cassone nuziale, in: Burlington Magazine,
Nr. 888, Vol. CXLX, März 1977, S. 178.
- Boskovits, Miklos: Ancora su Paolo Schiavo.
Una scheda biografica, in: Arte Cristiana, 1995,
Nr. 770, S. 332-340.
- Bayer, Andre / Cartwright, Sarah: Art and
Love in Renaissance Italy, Metropolitan
Museum of Art, New York 2009, Nr. 58b, S.
134-136.
- Lurati, Patricia: Doni d‘amore. Donne e rituali
nel Rinascimento, Pinacoteca cantonale Gio-
vanni Züst, Rancate (Mendrisio), 12.10.2014-
11.1.2015, Nr. 31, S. 100-101.
Diese seltene und prächtige Tafel mit der
langgestreckten Gestalt der Venus in einer
Landschaft und dem geflügelten Amorkna-
ben, die sich ein Band aus Blüten reichen, war
einst im Besitz des J. Paul Getty Museums in
Los Angeles und zuletzt anlässlich der grossen
Ausstellung „Art and Love in Renaissance
Italy“ im Metropolitan Museum in New York
2008/2009 in der Öffentlichkeit zu sehen. Nun
gelangt diese eindrückliche Arbeit nach langer
Zeit in Privatbesitz wieder auf den Markt. Sie
kann in die Zeit um 1440-45, dem Beginn der
italienischen Renaissance, datiert werden und
fungierte einst als Innenseite einer Hochzeitstru-
he (cassone), von denen heute nur noch wenige
erhalten sind.
Cassoni, in der die Braut ihre persönlichen
Gegenstände in das Eheleben überführte, waren
während der Renaissance nicht nur geschätzte
Möbelstücke für die Aufbewahrung kostbarer
Kleider und Textilien, sondern fungierten auch
als wichtige Prestigeobjekte in den häuslichen
Räumlichkeiten. Sie besassen auch einen
symbolischen Charakter und sollten der Ehe als
Glücksbringer dienen und vor allem Nachkom-
men garantieren. Dabei spielten die bemalten
Deckelinnenseiten eine wichtige Rolle, denn
diese enthüllten sich nur dem privaten Blick
ihrer Besitzer beim Öffnen der Truhen und
der Glaube, dass schöne Darstellungen einen
Einfluss auf das Empfinden der Braut und ihres
ungeborenen Kindes hatten, war weit verbrei-
tet (siehe Gombrich, Ernst H.: Apollonio di
Giovanni. A Florentine Cassone Workshop
Seen through the Eyes of a Humanist Poet, in:
Journal of the Warburg and Courtauld Institute
18, Nr. 1-2, Januar-Juni 1955, S. 27). Dement-
sprechend wurden Motive gewählt, die auf die
Liebe und die Fruchtbarkeit des Hochzeitspaa-
res anspielten, wie etwa Putti, Amoretten sowie
leicht bekleidete oder entblösste langgestreckte
männliche und weibliche Figuren, wie das hier
angebotene Gemälde exemplarisch vor Augen
führt.
Unserer Tafel wird von einer mit einem durch-
sichtigen Schleier leicht bekleideten Venus vor
einem tiefblauen, von Wolken durchzogenen
Himmelsband bestimmt. Venus stützt sich auf
drei mit Stoff überzogenen Kissen und greift das
Ende einer Blütengirlande, welche am anderen
Ende von einem geflügelten Amor gehalten wird
und sich in seiner Form wie ein Hochzeitsgürtel
anmuten lässt. Vergleichbare Kissen, sogenannte
„intimelle“, finden sich in einer Miniatur von
Apollonio di Giovanni (1415-1465) wieder (siehe
Thornton, Peter: The Italian Renaissance Interi-
or 1400-1600, New York 1991, S. 195, Abb. 219)
und suggerieren eine Anspielung auf Häuslich-
keit, in Kontrast zu dem pastoralen Hintergrund
der Szenerie. Sowohl das Motiv wie auch die
längliche, schmale Form der Holztafel belegen
ihre ursprüngliche Funktion als Innenseite des
Deckels einer Hochzeitstruhe.
Motivisch kann unsere Tafel mit den Innensei-
ten zweier casssoni von Giovanni di Ser Giovan-
ni Guidi, genannt Lo Scheggia (1406-1486) in
Verbindung gebracht werden, welche sich heute
im Statens Museum für Kunst in Kopenhagen
befinden (Inv. Nr. KMS4785 und KMS4786)
und ebenfalls je eine vergleichbare langgestreck-
te, unbekleidete Figur thematisieren (Abb. 1).
1971 untersuchte Federico Zeri das hier angebo-
tene Gemälde und brachte es mit einer Tafel in
Verbindung, die sich heute im Springfield Mu-
seum of Fine Arts befindet und die Geschichte
der Callisto darstellt (siehe Springfield, MA,
Museum of Fine Arts, Manuale delle Collezioni
Americane ed Europee, 1979, S. 117, Nr. 202).
Dabei vermutete er, dass diese zwei Tafeln
dieselbe Truhe ausschmückten. Die Zuschrei-
bung an Paolo Schiavo wurde zudem von Prof.
Everett Fahy bestätigt, als das Gemälde aus der
Sammlung des J. Paul Getty Museums verkauft
wurde.
Der Maler Paolo di Stefano Badaloni, genannt
Paolo Schiavo, war ein versierter und vielseitig
ausgebildeter Meister der Renaissance, der 1429
in der florentinischen Malergilde aufgenommen
wurde und nebst Altarwerken, Fresken und
cassoni auch zahlreiche Buchmalereien und
Vorzeichnungen für Tapisserien und Glasfenster
schuf.
Das Gemälde ist im Archiv der Fondazione Zeri
unter der Nr. 11839 als eigenhändiges Werk
von Paolo Badaloni, genannt Paolo Schiavo,
registriert.
CHF 250 000 / 350 000
(€ 231 500 / 324 100)
Abb. 1
Gemälde Alter Meister
| 20
















