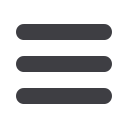
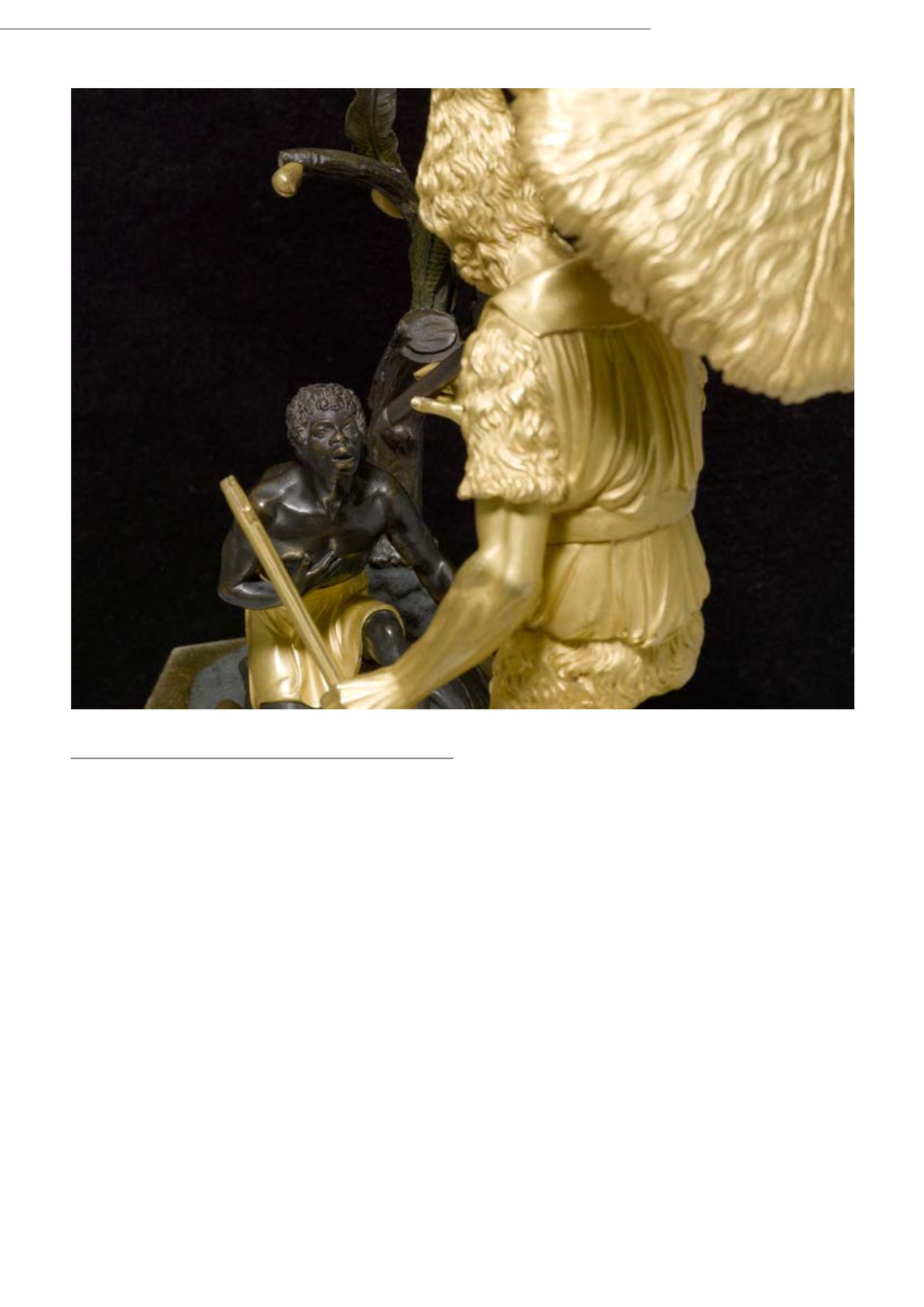 1274
KAMINPENDULE „ROBINSON ET VENDREDI“,
1274
KAMINPENDULE „ROBINSON ET VENDREDI“,
Empire/Restau-
ration, das Zifferblatt sign. vom Wiederverkäufer WUAN OWERKLIFT
DE DORCHDRECHT, um 1815/25,
Bronze matt- und glanzvergoldet sowie brüniert. Stehender Robinson in
Fellkleidung mit Schirm und Gewehr vor dem unter einer Palme knienden
Freitag mit Lendenschurz. Hohes, prismiertes Gehäuse mit Szenen aus
dem Leben des Robinson, auf Postamentsockel mit gequetschten Kugel-
füssen. Emailzifferblatt mit arabischen Minuten- und römischen Stunden-
zahlen. 2 feine, vergoldete Zeiger. Ankerwerk mit 1/2-Stundenschlag auf
Glocke. Ausserordentlich feine, matt- und glanzvergoldete Bronzebeschlä-
ge und -applikationen. 35,5x13,5x52,5 cm.
Provenienz: Privatbesitz, Schweiz.
Eine modellogleiche Pendule wurde in unserer September-Auktion 2005
(Katalognr. 1290) verkauft. Sie war publiziert in Art et Décoration 301
(Mai 1991), Les Pendules „au bon sauvages“; S. 132f.
Es sind lediglich drei weitere identische Exemplare bekannt: Die erste ist
Bestand der Sammlungen des Palazzo Pitti in Florenz, die zweite befindet
sich im Musée Duesberg in Mons, die dritte wurde in unserer Novem-
ber-Auktiion 1997 (Katalognr. 1140) verkauft. Eine Zuschreibung erscheint
schwierig; die Pendulen „au nègre“ werden üblicherweise J.S. Deverberie
zugeschrieben, jedoch sind keine Entwurfszeichnungen von ihm für dieses
Sujet bekannt. Andere Forschungen glauben in C. Galle den Urheber
dieser Pendule zu erkennen - doch auch dies wird durch keine zeitgenös-
sische Quelle belegt. Allen Forschungen und Hypothesen gleich ist die
Feststellung, dass es sich hierbei um eine Prunk-Pendule handelt, welche
„die kleinsten Details perfekt wiedergeben, die Ziselierung kaum zu über-
treffen ist“ (E.Niehüser).
Diese als „Rarissima“ zu bezeichnende Pendule offenbart auf meisterhafte
Weise die Übernahme literarischer Vorbilder - hier aus dem berühmten
und ausserordentlich beliebten Roman „Robinson Crusoe“ von D. Defoe -
in das Kunsthandwerk des Klassizismus.
Robinson Crusoe erlitt Schiffbruch und wurde an eine unbewohnte Insel
in der Orinokomündung gespült, wo er erst allein, dann mit einem befrei-
ten Eingeborenen, den er Freitag nannte, während 28 Jahren lebte. Freitag,
das Symbol des „bon nègre“, befreite Robinson aus der Gefangenschaft
der kannibalischen Eingeborenen und wurde sein Begleiter und Diener
- was dem Roman für die damalige Epoche erziehungspolitischen und
soziokulturellen Inhalt gab. Die Anregung zum Roman erhielt D. Defoe
hauptsächlich durch das Buch des Kapitäns W. Rogers, „A cruising voyage
round the world“ (1712), in dem vom schottischen Matrosen Alexander
Selkirk erzählt wird, der 1704-1709 auf der menschenleeren Robinson-Insel
lebte. Der Erfolg des Romans suchte seinesgleichen und veranlasste Defoe
zu zwei - weniger geglückten - Fortsetzungen (1719/20). Das Werk wurde
in sämtliche europäische Sprachen übersetzt und mehrfach als Erziehungs-
buch für die Jugend überarbeitet.
Lit.: E. Niehüser, Die französische Bronzeuhr - Eine Typologie der
figürlichen Darstellungen, München 1997; S. 160 (Abb. 261, die Pendule
aus dem Musée Duesberg in Mons). P. Kjellberg, La pendule française du
Moyen Age au XXe siècle, Paris 1998; S. 359 (Abb. F).
CHF 30 000 / 50 000
(€ 27 780 / 46 300)
Möbel & Kunstgewerbe |
Möbel, Uhren, Tapisserien, Bronzen, Sakrale Skulpturen, Porzellan, Silber
| 176
















