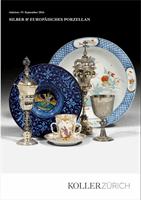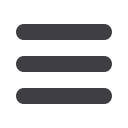
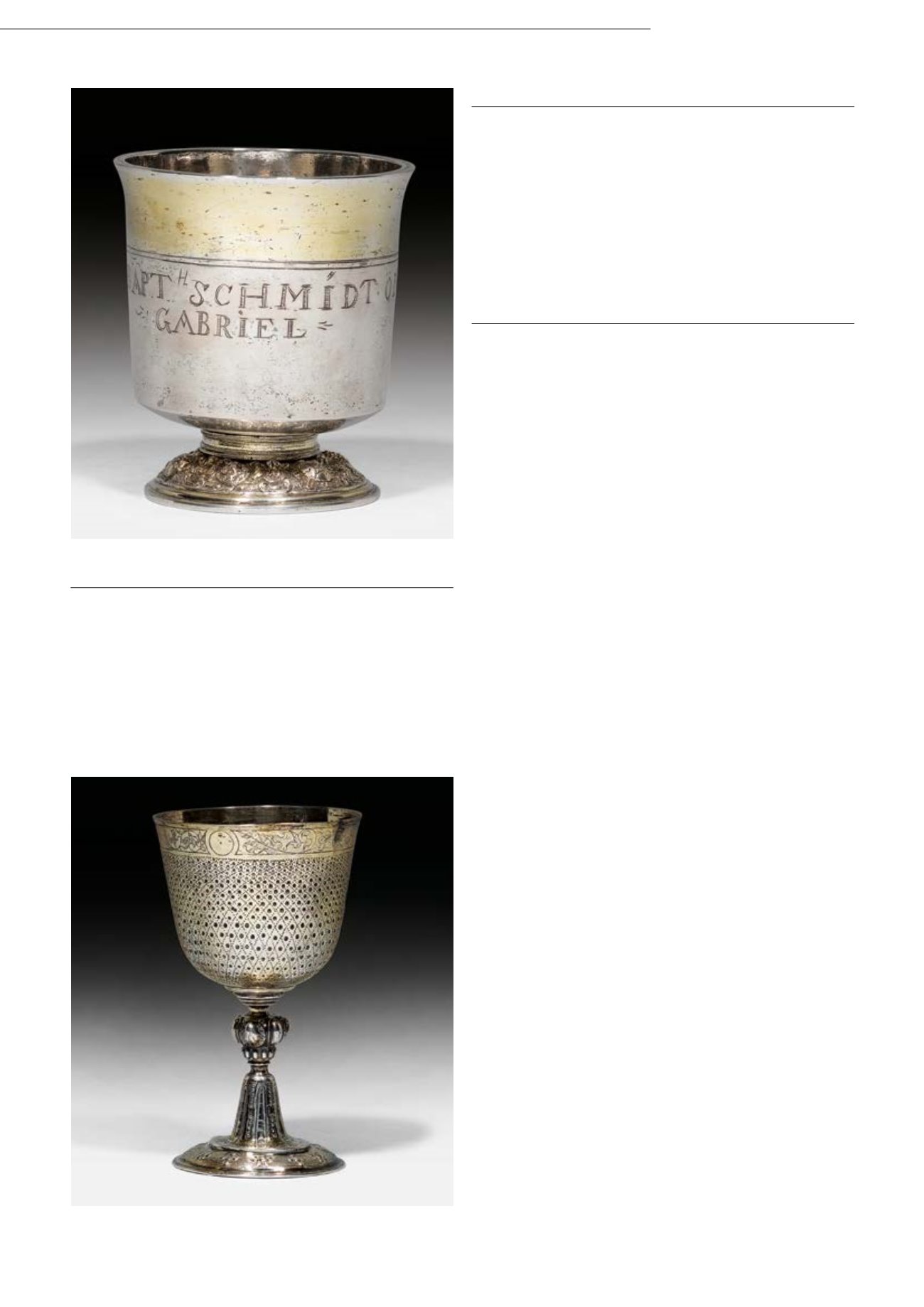
| 84
Kunstgewerbe |
Silber, Porzellan, Fayence & Objets de vertu
1875
HÄUFEBECHER, Sion, Ende 17. Jh. Meistermarke François-Joseph Ryss.
Zylindrischer Becher auf rund geformtem Fuss. Eingravierte Inschrift, demHei-
ligen Johannes demTäufer gewidmet. Dekor der Basis alternierend zwischen
Maskarons, Floral- und Rankenwerk. Teilweise vergoldet. H 9,5 cm. 185 g.
Provenienz: Sammlung U., Schweiz.
CHF 4 500 / 8 000
(€ 4 170 / 7 410)
1876
VERMEIL POKAL,Nürnberg, letztes Drittel 16 Jh. Meistermarke Hans
Pezold.
Auf profiliertem Rundfuss, mit umlaufenden Blüten auf punziertem Fond.
Schaft mit 6-passigem Nodus und stilisierten Muscheln. Glockenförmige
Cuppa mit netzartig ausgepunzten Rauten und kreisförmigen Punzierun-
gen. Lippenrand mit umlaufender Gravur. H 14,5 cm. 167 g.
Provenienz: Sammlung U., Schweiz.
CHF 3 000 / 5 000
(€ 2 780 / 4 630)
1877*
BECHER,Winterthur, 2. Viertel 17. Jh. Meistermarke Hans Hoffmann I.
oder II.
Teilvergoldet. Zylinderförmig mit leicht ausladendem Lippenrand. Auf
eingezogenem, profiliertem Rundfuss. Wandung umlaufend graviert mit
ländlichen Szenen einer Dorfhochzeit. Nach Vorlage von Kupferstichen
von Hans Sebald Beham (1500-1550). H 7,9 cm. 74 g.
Friedlich, ausgelassen und freudig feiernd zeigt sich die Dorfgemeinschaft
auf der glatten, gravierten Wandung des zylinderförmigen Bechers. Dem
Leben feierlich gesinnt, wirbeln sie tanzend über den Dorfplatz, rasten auf
einer Bank in der Sonne, oder geniessen das gesellige Beisammensein in
trauter Runde. Die ausgelassene Atmosphäre dieser ländlichen Szenerie
kommt deutlich zum Ausdruck und zeigt mit seinem klaren und feinen
Liniengefüge, Auszüge der Kupferstichserie
das Bauernfest
auch bekannt
als
die zwölf Monate
(1546/47) von Hans Sebald Beham (1500-1550).
Der in Nürnberg geborene und dort tätige Kunstschaffende gilt nebst seinem
jüngeren Bruder Barthel Beham (1502-1540) als einer der bedeutendsten
Kupferstecher und Buchillustratoren unter den Nürnberger Kleinmeistern
[AKL VIII, 1994, Sebald Beham, Iris Kalden-Rosenfeld und Jürg Rosenfeld].
Im Spätwerk der Gebrüder Beham stehen vor allem Darstellungen ausgelas-
sener Bauernfeste im Zentrum künstlerischer Auseinandersetzung und lassen
sich gemäss Bertram Kaschek als bildliche Kommentare zum Bauernstand
verstehen. Der thematische Aufgriff der Szenen, die auf dem hier zum Verkauf
stehenden Becher sorgfältig in einer dicht umlaufenden Wandung dargestellt
werden, zeigt zwei Auszüge der Stichfolge von Behams
Bauernfest
oder
zwölf
Monaten
. Zehn durchgehend nummerierte, kleinformatige Blätter bilden die
Kupferstichserie. Die über jedem männlichen Tanzpartner notierten Namen-
sinschriften stehen dabei für die Versinnbildlichung der zwölf Monate, so bei-
spielsweise FABIANVS IENNER (Januar) oder NICOLAVS CRISTMON
(Dezember). So zeigt dieser Becher unter anderem einen Auszug des fünften
Blattes (Abb. 2.) mit dem tanzenden Pärchen um EGIDIVS HERBSTMON
(September). Eine weitere bildliche Übernahme erfolgte anhand der Darstel-
lung des siebten Blattes (Abb. 1.) mit der Überschrift DIE ZWELF MONET
SENGEDHON. WOL AVF GREDTWIR FOENSWIDERON (Die
zwölf Monate sind getan. Wohl auf Grete, wir fangen nochmal an). Die Kraft
des stetigen Tanzes, die über die ersten sechs Blätter hinweg den Motor des
Lebens in Bewegung hält, wird durch die Darstellung des siebten Blattes und
dessen Inschrift verlangsamt. Dennoch bringt das wieder zum Tanzen be-
reitstehende Pärchen die Möglichkeit eines Neubeginns und die Fortführung
des anhaltenden Kreislaufes zum Ausdruck [Müller, Jürgen (Hrsg.): Bertram
Kaschek, Die gottlosen Maler von Nürnberg: Konventionen und Subversio-
nen in der Druckgrafik der Beham-Brüder (Ausstellungskatalog), Emsdetten
2011, S. 88-97)].
Das im Boden dieser sorgfältig und filigran ausgeführten Arbeit eingeschla-
gene Meisterzeichen lässt eine Zuschreibung an den Winterthurer Gold-
schmied Heinrich Hofmann d. Ä. (1597-1652) oder an dessen gleichna-
migen Sohn (1642-1696) zu, dies, da die Verwendung des Initialzeichens,
gemäss F.D. Rittmayer, von beiden Künstlern erfolgte. Nur wenig ist über
die Meister der angewandten Kunst bekannt, dennoch zeigt diese virtuose
Arbeit ein herausragendes Beispiel der Winterthurer Goldschmiedekunst.
CHF 4 000 / 8 000
(€ 3 700 / 7 410)
1876
1875