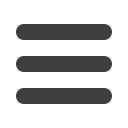

Möbel & Antiquitäten |
Möbel, Uhren, Tapisserien, Bronzen, Sakrale Skulpturen
| 174
I. Pleyel
I. Pleyel war sowohl als Klavierhersteller als auch als Komponist bekannt.
Musikalische Erziehung bereits als Kind erhalten haben, bildete er sich in
Wien und später bei J. Haydn (Joseph Haydn, 1732-1809) in Eisenstadt
weiter, ehe er in Strasbourg eine Stelle als Kapellmeister der Kathedrale
erhielt. Während der ersten Jahre der Revolutionswirren liess er sich in
Strasbourg nieder, um 1795 nach Paris zu ziehen, wo er zwei Jahre später
die Firma Maison Pleyel gründete. Diese editierte zunächst Partituren.
Zeitgleich entwickelte er neue Techniken für Tasteninstrumente, mit
welchen die Saiten durch Hämmern und nicht mehr durch Zupfen zum
Klingen gebracht wurden. 1807 liess er diese Technik patentieren und
eröffnete zwei Jahre später seine Manufactre de Piano. In der Restauration
wurde er zum "Facteur du Roi" ernannt und konnte so seine Produktion
markant erweitern. Gegen Ende der 1820er Jahre zog er sich langsam aus
dem Geschäfttsleben zurück und liess seinen ältesten Sohn Camille die
Firma führen, welche unter dem väterlichen Namen bis 1860 tätig blieb.
L.A. Bellangé
L.A. Bellangé, bekannt unter dem Namen Alexandre Bellangé entstammt
einer bedeutenden Pariser Ebenistendynastie und war Sohn von Luis
François, dem Bruder des Ebenisten Pierre Antoine Bellangé. Er lernte
seine Handwerkskunst im väterlichen Atelier, das er ab 1822 übernahm.
Er spezialisierte sich auf die sehr aufwendige Boulle-Marketerie, für
welche er in den verschiedenen Expositions Universelles (1827, 1834, 1839,
1844,1851 und 1855) zahlreiche Medaillen und Ehrungen sowie den Titel
"ébéniste en curiosité" erhielt; dies, weil er zwar Techniken der Vergan-
genheit verwendete, diese aber nicht im historisierenden Sinn anwendete,
sondern zugleich eine neue, eigene Dekorationssprache entwickelte. 1834
wurde er zum "Ebéniste de la Direction générale du Mobilier de la Couron-
ne" ernannt, acht Jahre später zum "Ebéniste du Roi". Bis zum Ende seiner
beruflichen Laufbahn war er als Hauptlieferant der Juli-Monarchie tätig.
Das hier angebotene Pianino stellt diesbezüglich ein sehr schönes Beispiel
dar, sind die Messingeinlagen nicht nur ungraviert (wie es im 18. Jahrhun-
dert und bei den Zeitgenossen üblich war), sondern die Einlagen weisen
auch eine ganz andere, "moderner" wirkende Ikonographie auf.
J.J. Feuchère
Auch J.J. Feuchère entstammt einer Dynastie von Bildhauern und lernte
seine Handwerkskunst im Familienatelier und später bei J.P. Cortot (Jean
Pierre Cortot, 1787-1843). Zugleich war er auch grosser Sammler und
entwickelte seine Vorliebe für Objekte im Stil der Neorenaissance, welche
er in den 1830er Jahren selber herzustellen begann. Die am Pianino vorzu-
findenden Bronzen offenbaren in vorzüglicher Weise seine "gewagte" und
ausserordentlich innovative Formensprache, in welcher die Einflüsse der
Renaissance zu einem "Neuen Ganzen" umgesetzt werden.
Lit.: N. Frederick, The Life of Chopin, London 1902 (2 Bde). A. Muhl-
stein, James de Rothschild, Paris 1981. J. Jude, Pleyel 1757-1857; passion
d'un siècle, Paris 2008. S. Cordier, Bellangé ébénistes, une histoire de goût
au XIXe siècle, Paris 2012. P. Prévost-Marcilhacy, Les Rothschild, bâtis-
seurs et mécènes, Paris 1995. D. Alcouffe / A. Dion-Tenenbaum,
Un âge d'or des arts décoratifs, 1814-1848, Paris 1991. D. Ledoux-Lebard,
Le mobilier du XIXe siècle, Paris 1989; 60f. C. Payne, Stilmöbel Europas,
Augsburg 1990; S. 29.
CHF 150 000 / 250 000
(€ 138 900 / 231 500)
1293
(Hôtel Laffitte)
1293
(Entwurfszeichnung)
















