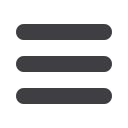
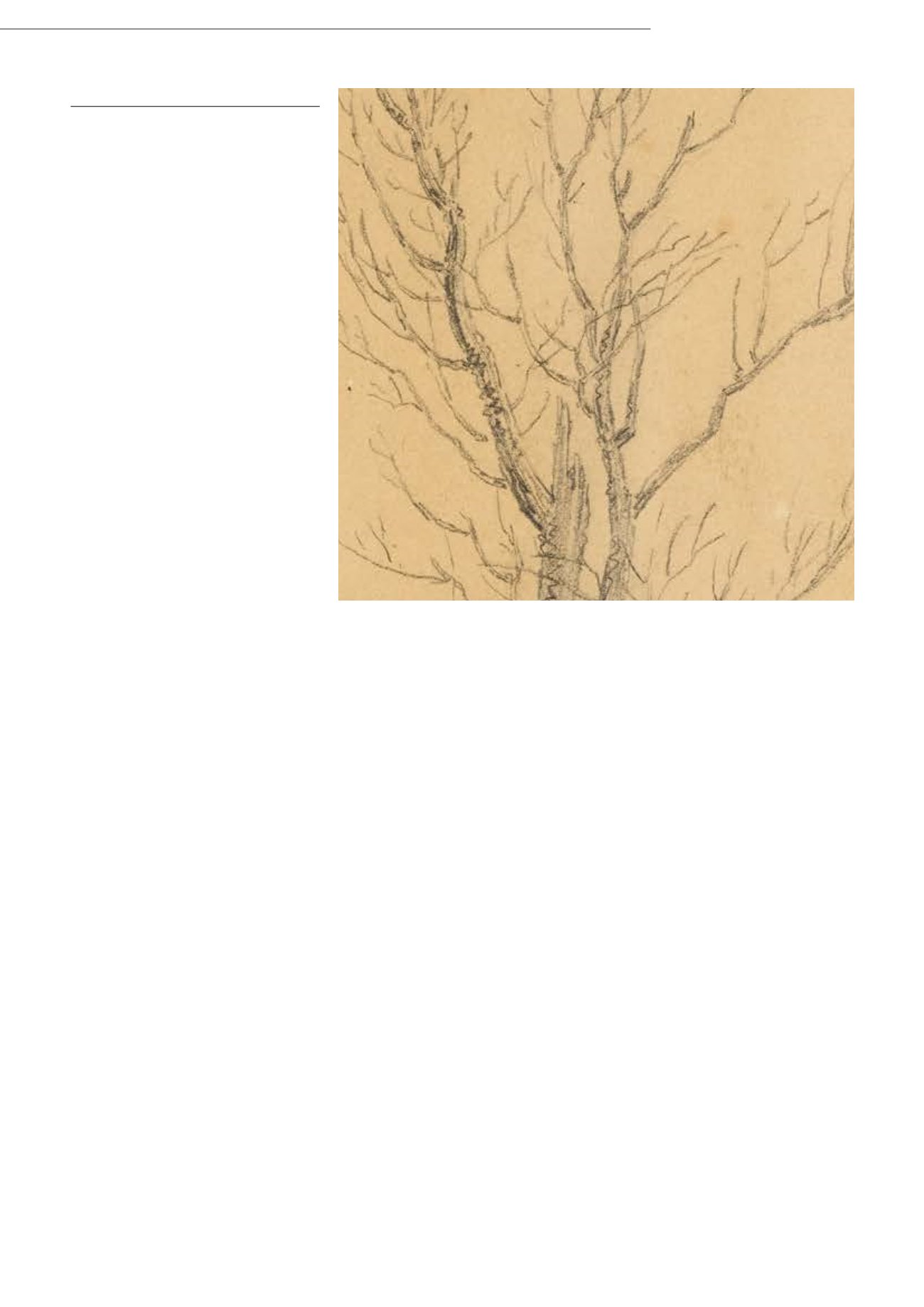
3457
FRIEDRICH, CASPAR DAVID(Greifswald 1774 - 1840 Dresden)
Baumstudie, 18. April 1803. Bleistift auf
lichtbraun grundiertem Velin. Mit Bleistift am
linken unteren Rand datiert: den 18t April 1803.
Unten rechts mit Bleistift nummeriert: 6. Verso
alt bezeichnet: Caspar David Friedrich. Von der
Kunsthalle Mannheim erworben am 24. April
1919. Heinrich Sachs. 20,5 x 13,2 cm (die obere
und untere rechte Ecke abgeschrägt und alt
ergänzt).
Provenienz:
- Kunsthalle Mannheim (bis April 1919)
- Heinrich Sachs (1894-1946) dort am 24. April
1919 erworben
- Kunstkabinett Ketterer, Stuttgart 1951
- Privatbesitz Schweiz
Literatur:
- Hinz, Sigirid. Caspar David Friedrich als
Zeichner. Dissertation; Greifswald, 1966 Nr.
341;
- Bernhard, Marianne. Deutsche Romantik.
Handzeichnungen München 1973. 2 Bde.,
S.857 ohne Abb.
- Ketterer. Gemälde, Plastik, Graphik,
Handzeichnungen, Aquarelle, Kunstliteratur;
Katalog zur Auktion 11, Stuttgart April 1951,
Lot 1331
- Börsch-Supan, Helmut/Jähning, Karl-Wil-
helm. Caspar David Friedrich. Gemälde,
Druckgraphik und bildmässige Zeichnungen;
München 1973, S.47, Anm. 62)
- Hoch, Karl Ludwig. Frömmigkeit und seine
Ehrfurcht vor der Natur. Dissertation, 1981,
S.152, Anm. 575
- Hoch, Karl Ludwig. Caspar David Friedrich
in Böhmen. Bergsymbolik in der romantischen
Malerei; Stuttgart u.a.1987, S.14 (Anm. 10)
- Grummt, Christina. Caspar David Friedrich,
Die Zeichnungen, Bd.1, Nr. 332 (ohne Abb.)
Mit leichtem und doch präzisem charakterisie-
rendem Strich ist eine junge Eiche gezeichnet,
deren kahle gestisch anmutende Äste nach oben
streben. Dass der Hauptstamm abgebrochen ist,
mag das Interesse Friedrichs gerade an diesem
Exemplar eines von ihm so oft dargestellten
Baumes geweckt haben. Die Verwendung der
bisher nicht abgebildeten, aber der Forschung
seit einem Versteigerungskatalog des Stuttgarter
Kunstkabinetts von 1951 bekannten Zeichnung
in einem Gemälde kann nicht nachgewiesen
werden. Ähnlich schlanke Eichen sieht man
jedoch etwa im Hintergrund des Dresdner
Bildes "Hünengrab im Schnee" von 1807. Die
energisch und rasch hingeschriebene Datierung
macht aus der Studie eine kleine Komposition.
Es ist Frühling, aber noch ist kein Laub an den
Ästen zu sehen. Das Blatt stammt aus einem
schon früh aufgelösten Skizzenbuch, von dem
Christina Grummt in ihrem Werkverzeichnis
von 2011 noch 18 zwischen dem 16. Mai 1802
und dem 6. Mai 1803 entstandene Zeichnun-
gen nachweist. Sigrid Hinz hat in ihrem nur als
Typoskript vorliegenden Werkkatalog "Caspar
Friedrich als Zeichner" von 1966 das Blatt
als Nr. 341 aufgeführt. Der Vermerk auf der
Rückseite "Caspar David Friedrich. Von der
Kunsthalle Mannheim erworben am 24. April
1919. Heinrich Sachs" deutet auf einen Herkunft
aus dem Nachlass des Malers. Dessen Enkel
Harald Friedrich (1858-1933) hatte, nachdem
Friedrich um 1900 wiederentdeckt worden war
und Museen sowie private Sammler Werke von
ihm zu erwerben suchten, einen grossen Teil der
Zeichnungen, die sich noch in seinem Besitz
befanden, 1916 der Mannheimer Kunsthalle
übergeben. Diese sollte den Verkauf an andere
Interessenten vermitteln. Darüber hat Hans
Dickel in der Einleitung des Bestandskataloges
der Kunsthalle "Caspar David Friedrich in seiner
Zeit. Zeichnungen der Romatik und des Bie-
dermeier" (Weinheim 1991, S.2-11) ausführlich
berichtet. Die Kunsthalle erwarb 44 Blätter, zum
Teil mit Zeichnungen auf der Rückseite. Der
gesamte Nachlass, darunter 13 Ölgemälde und
14 Sikzzenbücher, war 1843 auf einer Versteige-
rung angeboten worden, die offenbar jedoch nur
geringen Erfolg hatte.
Die Aussage der Zeichnung wird ganz verständ-
lich erst vor dem Hintergrund der Biographie
und der Entwicklung des künstlerischen
Denkens. Im Juli 1802 war Friedrich nach etwa
15monatiger Abwesenheit in seiner pommer-
schen Heimat nach Dresden zurückgekehrt. Er
hatte eine schwere seelische Krise zu bewälti-
gen, die noch nachklingt in den Werken, die
er auf der am 5. März 1804 eröffneten Akade-
mie-Ausstellung zeigt: eine grosse verscholle-
ne, aber durch Beschreibungen gut bekannte
Sepiazeichnung "Mein Begräbnis" sowie die
drei berühmten, von seinem Bruder Christian
ausgeführten Holzschnitte mit dem Ausdruck
abgründiger Melancholie. Auf der Ausstellung
von 1803 hatte er nur eine seiner meisterhaften
Rügen-Ansichten gezeigt. In diesem Jahr nun
entstand die erste Fassung seines bis 1834 noch
mindestens viermal variierten Zeitenzyklus,
in dem die Tageszeiten, die Jahreszeiten und
die Lebensalter zusammengefasst sind (Berlin,
Kupferstichkabinett, mit Ausnahme des ver-
schollenen Herbst-Blattes). Als Friedrich mit
dem Zyklus das Leitmotiv seiner künstlerischen
Weltanschauung formulierte, war er bereits 29
Jahre alt. Von nun an entfaltete sich seine Kunst
mit bewundernswerter Konsequenz und Schnel-
ligkeit bis etwa 1810 als eine ganz eigentümli-
che Gestaltungsweise, bei der auch die Praxis
seines Zeichnen vor der Natur eine bestimmte
Aufgabe erfüllt. Friedrich nahm, anders als die
älteren Dresdner Zeichner, die Hervorbringun-
gen der Natur als etwas Individuelles wahr. Er
porträtierte sie gleichsam wie Menschen. Dieses
Darstellungen waren dann Bausteine für seine
bedeutungsvollen Bilderfindungen und verliehen
ihnen in ihrer Authentizität Glaubwürdigkeit
im eigentlichen Wortsinn. Im Skizzenbuch von
1802/03 sind nur vier Baumzeichnungen in der
Art des vorliegenden Blattes erhalten. In einem
anschliessend benutzten in Karlsruher Privatbe-
sitz bewahrten, im Format etwas kleineren und
nur fragmentarisch überkommenen Skizzen-
buch finden sich acht Baumstudien in der Art
der 1803 gezeichneten. Hier ist nun Friedrichs
gewissenhafter Zeichenstil vor der Natur voll
entwickelt.
Prof. Dr. Helmut Börsch-Supan
CHF 25 000 / 35 000
EUR 23 150 / 32 410
3457
(Detail)
Zeichnungen des 15. - 20. Jahrhunderts
| 166
















